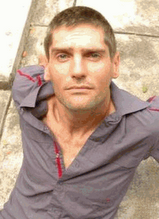Gestern rief Paula sehr aufgeregt bei mir an. Sie hatte in der Nacht zuvor folgenden Traum gehabt und wollte ihn von mir gedeutet haben:
Der Traum
Paula fährt mit ihrem Auto auf einer Landstraße. Sie spürt, dass ein kleines Mädchen hinten im Wagen sitzt und glaubt, dass es ihre Tochter ist. Die Landstraße mündet auf eine Autobahn, allerdings von der "verkehrten Seite", das heißt, Paula muss, um auf die Spur zum Einfädeln zu kommen, über die anderen Spuren Autobahn hinüber fahren. Allerdings ist das kein Problem, denn die Autobahn ist vollkommen leer. Nur ein einzelner Wagen kommt in großer Entfernung herangefahren. Paula fährt also los, doch in diesem Moment ist der andere Wagen heran. Darin sitzt ein Mann, der sich sehr erschrickt, die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und die Leitplanke durchbricht. Kaum ist das geschehen, ist die Autobahn voller Wagen, die plötzlich alle aufeinander fahren und gegeneinander stoßen. Auch von der Landstraße biegen LKW's und Busse auf die Autobahn ein und werden in den Massenunfall verwickelt. Dann schießt ein riesiger roter Truck über die Autos hinweg, und überschlägt sich mehrmals in der Luft. Paula denkt: sie muss hier unbedingt fort, sieht dann aber, dass der Truck über sie hinwegfliegen wird. Das geschieht auch. In diesem Moment wacht Paula auf.
Wahrträume
Wahrträume sind hellsichtige Träume, die die Zukunft vorhersagen. Paula rief an, weil sie Angst hatte, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Sie hatte vor fünfzehn das Autofahren aufgegeben, weil sie damals in einen Unfall verwickelt war. Damals hatte ihr ein Mann die Vorfahrt genommen, wodurch sie in dessen Wagen hineingefahren ist. Außerdem ist ihr ein anderer Wagen hinten drauf gefahren.
Paula hat erst vor einem Jahr sich wieder ein Auto gekauft und jetzt natürlich Angst, dass ihr wieder eine solche Situation passieren könnte.
Angstträume
Angstträume funktionieren ganz anders als Wahrträume: Angstträume verarbeiten in Bildern Ängste, über die sich der wache Mensch nicht bewusst ist.
Ich hatte bei Paula sofort die Gewissheit, dass ihr Traum kein Wahrtraum ist, sondern ein Angsttraum.
Ich schlug Paula zunächst vor, den Traum
symbolisch zu lesen. Das Auto, so deutete ich ihr, ist nicht ein echtes Auto, sondern ihr "sozialer Körper": dieser besteht aus sozialen Regeln. Paula verursacht als mit ihren sozialen Regeln Massenkarambolagen - dies habe ich ihr jedoch erst später gesagt. Zunächst einmal entdeckte Paula, dass es in ihrem Traum nicht um Unfälle, sondern um Streit geht.
Sie fährt friedlich vor sich hin (die Landstraße), will dann etwas zusammen mit anderen Menschen machen (die Autobahn) und automatisch kommt es zum Streit (Unfälle).
Paulas Leben
Hier stutzte Paula.
Tatsächlich hatte sie sich am Abend vorher heftigst mit ihrem Bruder gestritten.
Paula hat zwei Kinder, ein Junge (8) und ein Mädchen (11). Den Vater ihrer Kinder hatte sie kurz nach der Geburt ihres Sohnes verlassen, weil er gewalttätig geworden war.
Vor einem halben Jahr ist Paula dann zu ihrem älteren Bruder gezogen, weil dieser ein Haus besitzt und sie dort billig wohnen konnte. Bis dahin hatte sich Paula mit ihrem Bruder immer hervorragend verstanden. Jetzt aber wurde der Bruder - vor allem, wenn er getrunken hatte - sehr schroff und beleidigend. Immer häufiger kam es zum Streit. Paula wollte die Konflikte mit ihrem Bruder klären, woraufhin dieser sich immer mehr zurückzog und teilweise sich wie ein Kleinkind benahm. Wenn zum Beispiel Paula sagte: "Ich möchte mit dir reden!", verfiel ihr Bruder in eine quäkende Stimme und wiederholte Paulas Satz. Auch wenn Paula nicht direkt mit ihrem Bruder sprach, wiederholte er manche von Paulas Sätzen. Da ihr Bruder sonst ein angesehener und erfolgreicher Geschäftsmann ist, wurde Paula hier zunehmend hilflos. Andererseits kümmerte sich ihr Bruder auch wieder sehr liebevoll um sie, so dass Paula nicht das Gefühl hatte, ihr Bruder sei ihr gegenüber einfach nur boshaft.
2. Teil der Traumdeutung
Paula erzählte also von ihrem Bruder und dann von ihrem Lebensgefährten: auch diese hätten sich ihr gegenüber immer unverschämt oder kalt benommen und hatten ihr vorgeworfen, den Konflikt zu provozieren. Paula war extrem verunsichert, welche Rechte sie hatte. Tatsächlich hatte sich ihr Mann - der Vater ihrer Kinder - wie ein Pascha aufgeführt und ebenso verhielt sich ihr Bruder.
Paula verstand zwar jetzt einen Teil des Traums, fragte sich aber, warum sich der Mann im Auto vor ihr so erschrecken würde. Hier fiel ihr plötzlich auf, dass sie nicht von rechts auf die Autobahn einbog, sondern von links. Die nächste Deutung kam dann von ihr selbst: dass sie von links kam, könnte etwas mit der linken, emotionalen Gehirnhälfte zu tun haben. Sie sei ja so gefühlsbetont. Hier korrigierte ich sie: sie sei nicht gefühlsbetont, sondern habe einfach einen guten Kontakt zu ihren Gefühlen. Tatsächlich fand ich Paula nicht nur sehr reich an Gefühlen: sie konnte eigentlich auch sehr gut mit ihnen umgehen. Warum also war der Mann so erschrocken?
Zuvor hatte Paula schon vermutet, dass die ganzen Busse, die von der Landstraße in den Unfall hineindrängelten, ihre eigenen aufgestauten Gefühle waren. Jetzt legte ich ihr nahe, dass sie von vorne und von hinten, direkt und indirekt von Streit bedroht wäre. Dazu erzählte Paula, dass fast alle ihre Männer sie hinter ihrem Rücken schlecht gemacht hatten, und sogar ihr Bruder würde schlecht über sie reden. Ihr Bruder zum Beispiel behauptete, Paula würde absichtlich die Wohnung verdrecken lassen; etwas, was den Bruder vorher nie gestört hatte (obwohl er eigentlich ganz sauber ist). Paula dagegen hat das Gefühl, dass sie ständig hinter ihrem Bruder herräumt: sie kümmert sich um seine Wäsche, putzt dreimal die Woche das ganze Haus, usw.
Ihr Bruder aber scheint das nicht zu sehen. Wenn er mit ihr streitet, weist er auf die Unordnung hin, wenn er liebevoll zu ihr ist, sagt er ihr, sie sei eine tolle Schwester (er lobt sie also nicht für das Saubermachen).
Paula wunderte sich, dass sie, obwohl sie nie Streit haben wollte und es ihren Männern immer Recht machen wollte, diese so oft zu bösartigen Reaktionen veranlasste. Dass sie durch ihre Duckmäuserei die gewalttätigen Männer oder die aggressionsgehemmten Männer (diese fand sie furchtbar langweilig) anzog, wie ein Licht die Motten, das wollte Paula (noch) nicht sehen.
Paula's Bruder
Ihr Bruder legte im Streit diese seltsame Marotte des Wiederholens an den Tag. Tatsächlich war ihr Bruder ein sehr genauer Mensch, der aber im Alter von 48 noch nie eine feste Freundin hatte. Gegenüber Paula äußerte er sich, dass er eine Geliebte habe. Da er aber fast andauernd arbeitete und sonst zu Hause war, glaubt Paula ihm das nicht.
Paula empfindet diese Wiederholungen ihrer eigenen Sätze als sehr verletzend. Ich deutete diese Sätze als eine Art Mantra. Ihr Bruder würde sie nicht nachäffen, sondern über ihre Sätze meditieren. Wenn ihr Bruder solche Sätze wie "Ich möchte mit dir reden!" oder "Ich fühle mich verletzt!" andauernd und zu den unmöglichsten Gelegenheiten wiederholt, dann, weil er sie "schmecken" möchte, also wissen möchte, wie diese Sätze sich anfühlen.
Paula fand im Gespräch heraus, dass ihr Bruder nur Sätze wiederholt, die etwas mit Beziehung und Partnerschaft zu tun haben.
Ihr Bruder ist einsam und erfolgreich (der einsame Wagen auf der Autobahn). Dann kommt seine Schwester in sein Leben (sie biegt "falsch" ab), er erschrickt und es kommt zu einem andauernden Streit, der die bisherige, nette Beziehung zwischen den beiden vollkommen in Frage stellt (die Massenkarambolage).
Die Kindheit
Paula und ihr Bruder sind in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem sich die Eltern oft geprügelt haben.
Paula erzählte, dass sie ganz bewusst an sich gearbeitet hat, um nicht mehr so aggressiv zu sein. Als ich mit ihr sprach, hatte ich das Gefühl, dass sie hier eigentlich einen sehr guten Weg gegangen war. Sie war klar mit ihren Gefühlen und konnte sich sehr differenziert sehen.
Ihr Bruder hatte die Eltern strikt verleugnet. Beide waren in Heimen aufgewachsen und hatten sich erst spät kennen gelernt (Paula ist elf Jahre jünger). Während Paula ihren Gefühlen nachgegangen ist, bis sie einen guten Kontakt zu ihnen hatte, hat ihr Bruder diese Gefühle und damit auch seine Wut, sein Leid und seine Verzweiflung verdrängt. All die Gefühle, die guten, wie die schlechten, die für unsere Beziehungsfähigkeit so wichtig sind, lebte der Bruder nicht bewusst: sie sprudelten aus ihm heraus, ohne dass er richtig begriff, wie ihm geschah.
3. Teil der Traumdeutung
An dieser Stelle fiel Paula das kleine Mädchen ein, dass auf ihrer Rückbank saß, während sie - im Traum - Auto fuhr. Sie sagte, das sei ihre Tochter oder sie selbst. Sie sagte, sie müsse vorsichtig fahren, damit ihrer Tochter (ihr selbst) nichts passiere.
Ich fragte sie, ob sie denn vorsichtig fahren könne. Ja, sagte sie, sie ist immer eine gute Autofahrerin gewesen. Also müsse sie, sagte ich, nicht vorsichtig fahren, sie könne vorsichtig fahren. Was man sowieso kann, dann müsse sie sich nicht deutlich sagen.
Sie bejahte das und sagte zum ersten Mal im Gespräch, dass sie eigentlich garnicht weiß, warum sie sich selbst immer die Schuld gibt, wenn ihre Beziehungen scheitern. Und eigentlich sei sie sogar eine sehr starke Frau. Sie könne sich doch gut schützen und ihre Tochter habe damit auch keine Probleme. Nur: wer saß dann auf ihrer Rückbank?
Ich schlug vor: "Deine Mutter?"
Hier begann Paula zu weinen. Sie hatte ihre Mutter immer vor ihrem Vater schützen wollen. Aber gleichzeitig fand sie es nur gerecht, wenn ihr Vater ihre Mutter schlug, denn sie - die kleine Paula - ist selbst von ihrer Mutter sehr geschlagen worden.
Ihrer Mutter gegenüber fühlte sich Paula, auch nach dreißig Jahren, schuldig.
Du bist, sagte ich zu ihr, immer vorsichtig gefahren, um deine Mutter zu schützen und trotzdem sind deine Partnerschaften immer in Unfällen und Streit geendet.
Aber warum, fragte Paula, hat sich dieser Mann im Auto so vor mir erschrocken?
Vielleicht hat er dich zu spät erkannt, sagte ich. Hier weinte Paula noch stärker.
Und dann ist er entgleist.
Wohin jetzt?
Nachdem Paula sich beruhigt hatte, fragte ich sie, wie sie mit ihren Aggressionen gearbeitet habe. Sie war ja sehr reflektiert und eine richtige Fachfrau auf diesem Gebiet. Wie ich erwartet hatte, sagte Paula, dass sie sehr viele Bücher darüber gelesen habe.
Und was habe sie noch damit gemacht? fragte ich sie.
Wie? fragte sie zurück. Noch mehr?
Nein, sagte ich, noch etwas anderes?
Noch etwas anderes, als darüber nachzudenken?
Ja, sagte ich.
Aber, entgegnete sie, ich hätte doch gesagt, dass sie das sehr gut gemacht habe: sie hat einen guten Kontakt zu ihren Gefühlen, auch zu den negativen, und könne sich gut in andere Menschen hineindenken.
Außer in aggressive Männer, sagte ich.
Das stimmt. Und Frauen.
Hier schwiegen wir beide. Dann begann Paula wieder leise zu schniefen.
Sie habe, sagte sie, eigentlich ihr ganzes Leben versucht, ihre Eltern zu verstehen und warum sich diese ständig geprügelt haben. Doch jetzt könne sie zwar alle Menschen verstehen, aber gerade die, die sie habe verstehen wollen, die seien ihr fremd geblieben. Sie sei mit ihrer Lebensaufgabe gescheitert.
Ja, lächelte ich, aber auf eine sehr großartige Art und Weise.
An dieser Stelle spürte ich, nicht zum ersten Mal in diesem Gespräch, wie eine Welle wundervoller Energie von ihr ausging. Ja, dachte ich bei mir, diese Frau verdient eigentlich den besten aller Männer und nicht einen dieser huschigen Warmduscher oder dieser aggressiven Idioten.
Was kann ich denn jetzt tun? Werde ich noch einmal im Leben glücklich sein? fragte sie.
Ich wusste die Antwort eigentlich schon, zumindest auf die erste Frage. Paula hatte ihre Aggressionen gegen sich gewandt: ihre eigene Analyse war so etwas wie eine sehr vorsichtige Autoaggression. Sie war vorsichtig dabei und deshalb war die Autoaggression auch gut. Was ihr fehlte, zumindest teilweise fehlte, war eine gute Aggression nach außen.
Was ist eine gute Aggression nach außen? Das eine ist die Neugier und das Lernen, das andere die Kreativität.
Und genau das habe ich ihr dann auch empfohlen.
Paula wollte schon immer schreiben lernen. Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Also habe ich ihr versprochen, hier ein paar Schreibtipps hineinzustellen und ihr ein Buch zu empfehlen. Schreiben ist schon sehr diszipliniert und wer sich dazu nicht bereit fühlt, sollte auf das Skizzieren oder freie Tanzen zurückgreifen.
![]()
![]()
![]()
![]()