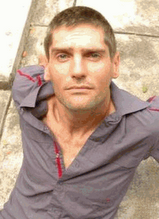Ich hoffe, ihr habt alle schöne Ostern gehabt.
Ich jedenfalls hatte sie.
Zu meinem Beitrag "Männer?" kommentierte Schwarze Wölfin, dass nicht nur Männer häufig veränderungsunwillig seien. Natürlich hat sie recht! - Ich war hier gerade etwas genervt von meinen Geschlechtsgenossen.
Spielregeln
In den letzten drei Tagen hat uns eine Frau etwas in Atem gehalten. Nennen wir sie der Einfachheit halber Astrid. Astrid ist die Mutter eines vierjährigen Mädchens. Der Vater dieses Mädchen - nennen wir ihn Timo - ist ein guter Freund von mir. Timo ist mittlerweile schwul.
Ich habe eine Tochter im selben Alter. Wir haben uns - wie sollte es sonst sein? - auf einem Spielplatz kennen gelernt.
Ostern haben wir gemeinsam verbracht. Timo und Astrid, meine Frau und ich, unsere Kinder. Nachmittags haben wir Spiele gespielt. Wir alle haben natürlich so gespielt, selbst mein zehnjähriger Sohn, dass die beiden vierjährigen Mädchen gewinnen würden und natürlich waren beide total stolz, als sie so weit vorne lagen und eigentlich sicher war, dass sie gewinnen würden.
Dann aber änderte Astrid - die Mutter - mitten im Spiel die Spielregeln ab, gegen die gebräuchlichen Spielregeln: hätten wir das durchgehen lassen, hätte sie das Spiel gewonnen.
Ich bin ziemlich sauer und dann auch laut geworden. Diese Regeländerungen wollte ich nicht durchgehen lassen. Schließlich hat Astrid auch beleidigt beigegeben.
Ich kenne Timo zwar erst seit zwei Jahren, aber er hat mir ziemlich viel von der Beziehung zu dieser Frau erzählt. Dass sie die Regeln mal so und mal so abändert, kommt ziemlich häufig vor. Timo spricht mit ihr zum Beispiel ab, dass er seine Tochter donnerstags vom Kindergarten abholt. Er kommt zum Kindergarten. Seine Tochter ist schon abgeholt worden - von Astrid natürlich. Er ruft sie an. Ja, sagt sie, sie hat es sich anders überlegt.
Freitags ruft sie ihn an, warum er seine Tochter nicht vom Kindergarten abholt. Timo wusste von nichts. Sie wirft ihm vor, er würde sich nicht um seine Tochter kümmern. Timo gerät in Panik. Er hat kein Sorgerecht und noch nicht mal ein Besuchsrecht für seine Tochter. Astrid hat gerichtlich erkämpft, dass er das nicht bekommt. Angeblich sei Timo zu labil.
Gut, Timo ist tatsächlich sehr labil. Aber er liebt seine Tochter und er ist ein hervorragender Vater. Timos Labilität zeigt sich eher gegenüber dieser Frau. Wir sprechen immer wieder darüber, dass sie die Wirklichkeit verdreht und dass sie die eine oder andere Tatsache einfach erfindet oder verändert oder weglässt. - Timo beschreibt sich selbst als vergesslich und hat immer wieder Angst, dass er tatsächlich irgendetwas falsch wahrgenommen hat.
Zu alldem kommt Timos Homosexualität. Astrids Eltern sind gegenüber Timo extrem feindselig. Der Streit wird hier über das kleine Mädchen ausgetragen. Timo sei, weil er homosexuell sei, für die Kleine gefährlich. Er würde sie, so behaupten die Großeltern, missbrauchen. Das hat die Kleine ihrem Vater wörtlich gesagt. Nur verstanden hat sie es - zum Glück! - nicht.
Wie Astrid hier, nur um zu gewinnen, die Spielregeln verändert, konnten wir beim Spielen eines Brettspieles deutlich beobachten. Und nach allem, was ich von Timo erfahren habe, macht sie es in ihrem sonstigen Leben genauso.
Mein Streit mit Astrid hatte dann folgende Auswirkung: Astrid hat am nächsten Morgen Timos Schwester angerufen und ihr erzählt, dass Timos Freund - hier wurde ich also mal rasch homosexuell gemacht - Timo gegen sie und ihre Tochter aufhetzen würde.
Die Schwester war sehr beunruhigt. Timo hatte eineinhalb Jahre nach der Geburt seiner Tochter einen Nervenzusammenbruch gehabt. Er hatte sich damals schon entschieden, schwul zu leben. Der Arzt in der Nervenklinik hatte sie damals eingeladen, um hier ein "klärendes" Gespräch mit beiden zu führen. Daraufhin schilderte Astrid die Beziehung zu Timo zunächst in den leuchtendsten Farben, und dann sei er plötzlich, aus heiterem Himmel, komisch geworden. Der Arzt sagte dann, vor Astrid und vor Timo, schwere psychische Erkrankungen kündigten sich häufig durch homosexuelle Verschmelzungstendenzen an.
Natürlich war die Beziehung zwischen Astrid und Timo nie einfach und auch eigentlich recht kurz gewesen. Von einer Bilderbuchbeziehung konnte man schon garnicht sprechen. Timo reagierte auf diese Beschreibung von Astrid sehr aggressiv. Dies kommentierte der Arzt damit, Timo würde die Wirklichkeit verkennen und Astrid brauche sich keine Sorgen zu machen.
Hier wird sehr deutlich, wie die Annahme, jemand sei psychisch krank, seine eigentlich gesunde Reaktion als krank erscheinen lässt.
Auch Timos Schwester ist immer in Hab-Acht!-Stellung. Sie liebt ihren Bruder sehr, aber sie hat Angst, dass er wieder zusammenbricht.
Astrids Anruf bei ihr hat sie alarmiert. Sie hat dann bei Timo angerufen und, wie sie mir später erzählte, herauszuhören versucht, ob Timo wirklich wieder "krank" wird. Dadurch war der Anruf natürlich sehr verwirrend. Timo wusste nicht, nach welchen Spielregeln seine Schwester spielt, während seine Schwester ihn schonen wollte und ihm ihre Spielregeln nicht erklärt hat. Der Anruf ist also seltsam verlaufen. Jetzt war Timo richtig verwirrt, denn er hatte das Gefühl, seine Schwester sei ärgerlich auf ihn, wolle ihm dies aber nicht zeigen. Die Schwester hingegen dachte, dass Timo durch einen bevorstehenden Nervenzusammenbruch so seltsam reagiert, und war ihrerseits sehr verwirrt, was sie nun tun sollte.
Von Astrids Anruf bei der Schwester wurde natürlich kein Wort gesagt.
Timo hat uns dann gebeten, mit seiner Schwester zu telefonieren, um herauszufinden, warum sie ärgerlich auf ihn ist.
Mir hat sie dann natürlich von Astrids Anruf erzählt, und ich konnte hier eine Gegendarstellung zu Astrids Geschichte liefern.
Daraufhin löste sich das Ganze - glücklicherweise - in Wohlgefallen auf.
Nicht nur Brettspiele haben Spielregeln. Auch Beziehungen haben ihre offiziellen und heimliche Spielregeln.
Astrids Spielregeln scheinen zu lauten: Ich mache die Spielregeln! Ich gewinne immer, notfalls, indem ich die Spielregeln ändere!
Natürlich gehören hier zwei Seiten dazu. Timos Spielregel lautet eher: Ich passe mich immer an! - Als Astrid die Regeln des Brettspiels zu ihren Gunsten geändert hat, hat ja nicht Timo eingegriffen, sondern ich.
Timos zweite Spielregel lautet: Auf heimliche Regeländerungen reagiere ich verwirrt und denke, dass ich Schuld habe, wenn ich verwirrt bin! - Das ist ein Teufelskreis: Statt hier die Spielregeln deutlich einzufordern, die bisher üblich waren, versucht Timo sich hier an Regeln anzupassen, die er manchmal garnicht kennt, und scheitert damit natürlich.
Timo versucht hier also, den Konflikt zu vermeiden und beschwört damit einen meist noch viel schlimmeren Konflikt herauf: das fehlende Sorgerecht und Besuchsrecht für seine Tochter, der Nervenzusammenbruch. - Und das ist tatsächlich nicht Astrids Verantwortung. Das muss er selbst lernen.
Zirkuläres Fragen
Seltsamerweise hat mir das Osterfest noch eine schöne kleine Überraschung gebracht. Ein anderer Freund versorgt mich immer mal wieder mit Büchern, und diesmal sollte es das Buch "
Zirkuläres Fragen" von Fritz B. Simon und Christel Rech-Simon sein.
Die beiden Autoren bieten ein höchst vergnügliches Lehrbuch der Systemischen Therapie mit recht ausführlichen Protokollen aus Therapiesitzungen. Es lohnt sich, das zu kaufen.
Die systemische Therapie beschäftigt sich mit solchen Fragen wie: Welche Spielregeln gilt für welches Familienmitglied? - Das Buch passte hier also hervorragend zu unserem Erlebnis mit Astrid und Timo.
Der helfende Dritte
In dem Buch findet sich ein Fallbeispiel, in dem sich eine Frau als therapieresistent zeigt.
Tatsächlich ist die Ehe der Frau eigentlich keine schöne Ehe. Die Ehe führt zu Belastungen. Die Frau wird krank. Sie geht in die Therapie, um sich von ihrer Krankheit therapieren zu lassen. Dann geht sie zurück in die Ehe.
Der Therapeut, der hier mit der Frau arbeitet, hilft also Mann und Frau eine Ehe aufrecht zu erhalten, die die beiden ohne Hilfe nicht ertragen könnten. - Der Mann scheint hier dem Therapeuten die Aufgabe zuzuschieben, sich um das seelische Wohl seiner Frau zu kümmern, wie ein guter Ehemann das tun würde. Gleichzeitig kann der Mann aber sicher sein, dass der Therapeut kein ernsthafter Konkurrent ist: der Therapeut darf keine sexuelle Beziehung zu der Patientin einnehmen.
Hier also ist das Problem, dass der Therapeut nicht die Lösung des Problems ist. Er gehört zu dem Problem mit dazu. Und solange er Therapeut bleibt, existiert dieses Problem auch weiter. Kein Wunder also, dass keine Therapie bei der Frau anschlägt.
Umgekehrt ist natürlich, dass der Therapeut, wenn er seine Rolle aufgibt, automatisch die Ehe gefährdet, was zu einem Abbruch der Therapie führt. Offiziell und vielleicht sogar berechtigterweise hat hier der Therapeut seine Kompetenzen überschritten oder sie nicht genügend erfüllt. Inoffiziell hat er natürlich die heimlichen Spielregeln zwischen den Ehepartnern durchbrochen: der Therapeut kümmert sich um die Frau, der Mann bezahlt, die Frau ist krank, der Mann hat als einziger sexuellen Kontakt mit ihr.
Diese Arbeit mit den Spielregeln ist ein sehr machtvolles therapeutisches Instrument.
Herr Simon und Frau Rech-Simon schildern in ihrem Buch humorvoll und spannend die Auswirkungen solcher Spielregeln und wie man dann konkret mit ihnen umgeht. Zudem ist das Buch hervorragend lesbar.
Insofern war dieses Ostern höchst lehrreich für mich.
Euer
Adrian