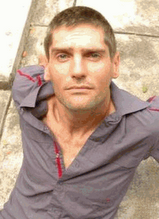Was mich immer wieder fasziniert, ist, dass sich so viele Menschen stundenlang darüber unterhalten können, welcher Mensch an welcher Tatsache Schuld ist.
Ich hatte neulich etwas über Familienterroristen geschrieben. Familienterroristen sind diese unangenehmen Menschen, die eine ganze Familie in den Wahnsinn treiben, sei es durch depressive Verstimmungen, durch emotionale Erpressung oder durch Hass, Zorn und Lüge.
Doch ebenso oft, wie man von solchen Menschen hört, die ganze Familien zerstören, hört man von Diskussionen, ob man zum Beispiel den Täter als Opfer sehen soll, ob man ihn auch als Opfer behandeln soll. Denn der Täter ist sehr oft ein Mensch, der selbst sehr viel Unrecht erlitten hat.
Kati und Jana
Kati und Jana sind zwei gute Freundinnen.
Nur in einem Punkt streiten sie sich sehr gerne. Seit vielen Jahren hat Kati Streit mit ihrer Tante. Diese Tante mischt sich andauern in Familienangelegenheiten ein, lügt, droht und erpresst. Kati wehrt sich gegen ihre Tante. Jana findet das nicht gut: sie behauptet, dass Katis Tante selbst ein misshandeltes Kind ist und damit nur ein Opfer. Wenn Kati jetzt gegen ihre Tante gerichtlich vorgeht, dann würde sie ihr noch mehr Leid zufügen.
Kati's Familie
Kati kommt aus einer großen Familie mit vier Geschwistern und ist dort die jüngste. Sie hat ihr ganzes Leben lang unter ihren Eltern gelitten und mehr noch unter ihrer Tante. Katis Mutter war eine sehr stille, schüchterne Frau. Sie hatte in ihrem Leben nie etwas gewagt. Der Vater dagegen war ein sehr gewalttätiger Mann. Er hatte neben seiner Frau eine Anzahl von langjährigen Affairen gehabt und mit diesen Frauen eine Reihe von Kinder gezeugt. Gekümmert hat er sich nie um seine Kinder.
Katis Tante hat keinen erfolgreichen Mann geheiratet. Sie lebten eine recht eisige Ehe. Katis Tante war immer eifersüchtig auf ihre Schwester und hat diese - wie Kati erzählt - fertig gemacht, wenn sie sich beschwert hat. Nachdem Katis Mutter gestorben war, ist Katis Vater ruhiger geworden und hat den Kontakt zu seinen Kindern gesucht. Diese haben den Vater teilweise überhaupt nicht akzeptiert oder einfach nur ausgenutzt, dass ihr Vater viel Geld hat.
Kati dagegen hat, nachdem sie Bürokauffrau gelernt hat, zahlreiche Therapien gemacht. Alle ihre Beziehungen waren rasch in die Brüche gegangen. Die Männer warfen ihr vor, kalt, boshaft, niederträchtig zu sein. All das verstand Kati nicht und allmählich fühlte sie sich ziemlich verrückt. Nach etlichen Jahren der Therapie verliebte sich Kati schließlich in einen Mann, zog mit ihm zusammen und heiratete ihn. Jetzt - nach zwanzig Jahren Ehe - hat der jüngste Sohn gerade seine Lehre angefangen.
Vor zwanzig Jahren hat Kati auch den Kontakt zu ihrer Familie weitgehend abgebrochen. Nur mit einer Schwester und einem Bruder traf sie sich weiterhin regelmäßig. In der Zwischenzeit hat Kati sich viele Gedanken über ihre Familie gemacht. Katis Tante hat sich weiterhin, teilweise mit boshaften Behauptungen und Lügen, teilweise mit massivem Streit und Beleidigungen, in die Familienangelegenheiten von Kati eingemischt.
Als Katis Mutter schwer an Krebs erkrankte, behauptete ihre eigene Schwester, Katis Tante, die Mutter habe daran selbst Schuld. Es sei die Strafe dafür, dass sie nie eine gute Ehefrau gewesen sei und ihr Mann ihr fremdgehen musste. Katis Tante hat ebenso behauptet, dass Kati ihrem Mann fremd gehen würde, was zu einer langen Entfremdung zwischen Kati und ihrem Mann geführt hat und die Kinder massiv belastet hat. Heute ruft Katis Tante regelmäßig im Betrieb an, in dem ihr Neffe - Katis jüngster Sohn - seine Lehre macht und erklärt dem Meister die "Wahrheit" über die Familie.
Was Jana glaubt
Jana hat einen ebenso langen Leidensweg hinter sich wie Kati. Während aber Kati massiv gegen ihre Tante vorgeht und sich und ihre Familie vor dieser zu schützen versucht, duldet Jana viele Gewalttätigkeiten, die in ihrer eigenen Familie passieren.
Jana sagt, dass alle diese bösen Menschen selbst so viel Gewalt erlitten haben, dass sie garnicht anders können als böse zu sein. Deshalb dürfe sie - Jana - nicht auch noch Schlechtes tun.
Obwohl Jana und Kati sich sonst gut verstehen, streiten sie sich über dieses Thema regelmäßig. Kati besteht darauf, sich zu schützen. Jana sagt, man müsse mit den Tätern Mitleid haben. Kati würde, so Jana, die ganze Sache nur noch schlimmer machen. Die Täter seien Opfer und als Opfer müsse man sie auch behandeln.
Täter/Opfer
Ich habe hier einen längeren Umweg über die Familiengeschichte von Kati gemacht.
Sicherlich kennen Sie ähnliche Situationen. Oft sind diese nicht so extrem wie bei Kati, aber auch hier dreht sich immer wieder die Frage darum, wer an was Schuld ist. Es geht hier ganz ausdrücklich um die Frage, wer ein Täter und wer ein Opfer ist und wie man wen schützt.
Denn Kati hat ja sehr Recht, wenn sie ihren Sohn schützen will: die Tante gefährdet durch ihre Anrufe dessen Lehrstelle.
Rache
Mein erster Gespräch mit Kati drehte sich um ihre Tante.
Kati beschrieb sie als eine verbitterte, alte Frau, die sich an jedem Familienmitglied rächen würde, dem es besser gehe als ihr selbst.
Kati beklagte sich gleichzeitig über ihre Freundin Jana, die sagte, man müsse ihre Tante lieben und Mitleid zeigen. Wie aber solle sie - Kati - mit einer Frau Mitleid haben, die so viel Böses verursacht?
Ich wies Kati zunächst darauf hin, dass Mitleid hier natürlich nicht angebracht ist. Das Problem mit dem Mitleid ist, dass es die Situationen nicht klärt und dass es das Verhalten von Katis Tante unterstützt.
Was also ist Rache?
Rache bedeutet zunächst, dass man einem anderen Menschen einen Schaden zufügen will, den man von diesem erlitten hat. Du hast mich geschlagen, also schlage ich dich. Das ist Rache.
Im Fall von Katis Tante aber passiert folgendes: Katis Tante weiß eigentlich nicht, wer sie verletzt hat. Sie ist zwar ein Opfer. Da hat Jana schon Recht. Aber wer ist der Täter?
Katis Tante jedenfalls scheint zu glauben, dass ihre Familie insgesamt ihr Böses tut und das gibt sie - seit vielen Jahren - an diese zurück. Helfen tut ihr das nicht. Im Gegenteil: sie wird immer verbitterter.
Dass sie immer verbitterter wird, ist allerdings kein Wunder. Wer sich rächt, fühlt sich beschädigt und hilflos. Katis Tante fühlt sich zutiefst beschädigt. Ihre Verletzungen sind seelische Verletzungen. Doch statt an ihren Verletzungen zu arbeiten, manipuliert sie die Umwelt.
Es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis Kati verstanden hat, was ihre Tante damit auch noch sagt:
Erstens glaubt Katis Tante, dass sie sich selbst heilen könnte, wenn sie ihre Umwelt auf die richtige Art und Weise manipuliert. Da sie keinen Erfolg mit ihren Manipulationen hatte, dachte sie, sie habe zu wenig manipuliert. Also hat sie immer mehr auf ihre Umwelt eingeschlagen und noch mehr und noch mehr, bis sich schließlich alle Menschen von ihr abgewendet haben, weil sie so eine grausame und verbitterte Frau war.
Zweitens aber glaubt Katis Tante, dass sie keine Macht über sich selbst hat. Sie kann nicht an sich selbst arbeiten, weder daran, wie sie selbst verletzt worden ist, noch daran, wie sie andere Menschen verletzt.
Rache bedeutet, andere Menschen für sich die Seelenarbeit machen zu lassen.
Damit aber erniedrigt sich Katis Tante selbst: sie hat keine Macht über sich, und gibt alle Macht den anderen. Zugleich ist das natürlich eine Illusion. Denn sie übt ja durch ihre Rache eine ungeheure Macht aus. Dafür aber ist Katis Tante blind.
Kati's Problem und Jana's Problem
Wenn Kati sich nun gegen ihre Tante wehrt, hat sie natürlich Recht.
Warum aber hat sich Kati bis dahin immer wieder von Jana verunsichern lassen? Kati hat zwar schon vor vielen Jahren festgestellt, dass ihre Tante ebenso misshandelt wurde aber sollte sie deshalb einfach nur Mitleid mit ihr haben und zusehen, wie diese Frau ihren Hass und ihre verdrehte Wahrheit in die Welt hinausschleudert?
Kati selbst hatte - meiner Ansicht nach - zunächst ein ganz anderes Problem: sie hat nicht verstanden, weshalb ihre Tante so handelt, wie sie handelt. Es ist zwar richtig, dass die Tante als Kind sehr gelitten hat, aber dieses alte Leid hat sich im Laufe der Zeit geändert. Katis Tante weiß nicht mehr, was ihr als Kind passiert ist. Sie hat diese Erinnerungen verdrängt. Dafür "weiß" sie aber, dass zum Beispiel Kati "böse" und "kaltherzig" ist.
Sowohl Kati als auch Jana haben in ihrem Urteil über die Tante nur das kleine, misshandelte Kind und ihr jetziges Verhalten gesehen. Was dazwischen passiert ist und was Katis Tante im Moment glaubt, haben sie nicht berücksichtigt.
Es geht also darum, wie man Katis Tante verstehen soll und welches Verhalten man akzeptieren muss.
Sprechen über ...
Jana wirft Kati vor, dass sie ihre Tante nicht als Opfer sieht. Kati sagt häufig: die Täterin, wenn sie von ihrer Tante spricht.
Damit hat Kati Recht: man muss es eben in dem richtigen Rahmen sehen.
Wenn Kati sagt, ihre Tante sei Täterin, dann tut sie zweierlei:
Sie weist ihrer Tante eine Rolle zu.
Sie drückt aus, dass sie unter dem Verhalten ihrer Tante leidet.
Sprache hat immer diese beiden Funktionen: einmal teilt sie die Welt ein, zum anderen drücken wir mit der Sprache aus, wie wir uns in der Welt befinden. Sprache teilt die Welt ein, Sprache platziert uns in dieser Welt.
Jede Naturwissenschaft teilt die Welt ein: sie teilt sie in Belebtes und Unbelebtes ein, in Tiere und Menschen, in Männer und Frauen, in Atome und Elemente, in Hunde und Katzen. Unser tägliches Reden über diese Welt ist das Fundament jeder Wissenschaft.
Zugleich platzieren wir uns in der Welt. Wenn ich sage: "Ich habe Hunger!", dann sage ich auch, dass es irgendwo etwas Essbares für mich gibt, und dass dieses Essbare meinen Hunger stillen wird. Ich kann zum Beispiel in die Küche gehen und mir ein Brot machen. Das Beispiel ist jedoch zu einfach. Wenn ich sage: "Ich bin arm.", sage ich zugleich, dass andere Menschen reich sind. Wenn ich sage: "Du verkaufst Brötchen.", sage ich zugleich, dass ich bei dir Brötchen kaufen kann. Wenn ich sage: "Du bist ein Täter.", sage ich zugleich, dass jemand anderes ein Opfer ist.
Wenn Kati also sagt, ihre Tante sei eine Täterin, dann sagt sie gleichzeitig, dass sie ein Opfer ist. Kati teilt hier die Welt ein, zumindest einen Teil der Welt. Und zugleich sagt sie: Hier stehe ich!
Verstehen
Verstehen bedeutet zunächst, dass man die Welt einteilt.
Ich verstehe zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die Brote verkaufen und dass es Menschen gibt, die keine Brote verkaufen. Dies ist aber noch die albernste Art und Weise des Verstehens.
Verstehen bedeutet auch, dass ich weiß, wie etwas entstanden ist. Brotverkäufer hat es nicht immer gegeben. Früher haben die Menschen ihre Brote auf flachen Steinen geröstet und es waren eher Brote als Fladen. Dann haben die Menschen einen Dorfofen gehabt, den man einmal in der Woche angefeuert hat und jede Familie konnte dort ihre Brote backen. Später haben bestimmte Menschen Öfen für sich gehabt und jeden Tag Brote gebacken, die sie dann getauscht und schließlich verkauft haben. Heute gibt es Maschinen, die Brot backen, Menschen, die diese Brote von der Fabrik zu den Verkaufstellen bringen und Menschen, die diese Brote verkaufen.
Auch das ist ein einfaches Beispiel.
Schwierig wird es erst, wenn man - wie Kati - jemanden als Täter bestimmt. Zunächst muss ich verstehen, dass Katis Tante eine Täterin ist. Dann aber muss ich verstehen, wie sie zu einer solchen Täterin geworden ist. Jana verweist hier auf die schwierige Kindheit. Das ist richtig, aber zu wenig. Katis Tante hat sich ja nicht in einem Moment von dem misshandelten Kind in eine rachsüchtige Frau verwandelt. Die Tante hat nicht nur akzeptiert, dass sie ein Opfer ist, sie hat auch akzeptiert, dass sie heute noch ein Opfer ist. Und die Tante hat aufgehört, sich selbst zu verstehen. Jeder Mensch kann sich selbst verstehen. Zwar kann ich mich nie vollständig verstehen, aber zumindest in großen Teilen.
Und dass Katis Tante sich selbst nicht mehr verstehen will, dass muss Kati nicht akzeptieren.
Akzeptieren
Neben dem Verstehen gibt es das Akzeptieren. Damit drücken wir aus, was wir hinnehmen und was wir nicht hinnehmen. Damit drücken wir auch aus, ob wir handeln sollten oder nicht handeln sollten.
Ich akzeptiere zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die Brot verkaufen. Natürlich könnte ich auch sagen: das akzeptiere ich nicht. Ich könnte dafür werben, dass jeder Mensch sein Brot wieder selbst backt, dass jeder Mensch sein eigenes Getreidefeld hat, sich selbst Korn mahlt, den Sauerteig ansetzt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich damit Erfolg habe.
Kati ist allerdings in einer anderen Situation.
Unsere Gesellschaft stützt sich darauf, dass bestimmte Menschen Brote verkaufen und andere diese Brote herstellen, damit nicht alle Menschen jeden Tag ihre Nahrung selbst herstellen müssen. Nur so können Ärzte den ganzen Tag lang Ärzte sein, und Ingenieure den ganzen Tag lang Ingenieure. Brot können sie trotzdem immer essen, weil sie es sich einfach kaufen.
Kati aber muss nicht hinnehmen, dass ihre Tante sich an ihr und ihrer ganzen Familie rächt. Sie muss auch nicht akzeptieren, dass Jana sagt: Du musst Mitleid mit deiner Tante haben.
Sicher: es ist für Kati besser, wenn sie genauer versteht, warum ihre Tante sich so verhält. Aber sie kann auch einfordern, dass ihre Tante sich selbst versteht oder verstehen lernt.
Gerade auf der persönlichen Ebene greifen Verstehen und Akzeptieren ineinander und dies macht Beziehungen oft auch so kompliziert.
Wenn Jana und Kati miteinander sprechen, sollten sie dies aber gut auseinander halten.
Denn wenn Kati ihre Tante nur versteht, macht sie sich selbst hilflos. Und wenn Kati ihre Tante nicht verstehen will, folgt sie einer sehr kriegerischen Logik.
Unsere Sprache aber macht ja beides und beides gleichzeitig: sie versteht und sie akzeptiert. Unsere Sprache versteht, indem sie die Welt einteilt. Ich sage zum Beispiel: Die neue Fernsehserie ist langweilig! und teile damit die Welt ein: es gibt Fernsehserien im Unterschied zu Fernsehfilmen, im Unterschied zu Kinofilmen, im Unterschied zu Büchern, zu Autor, zu Politikern und zu Steinzeitmenschen. Es gibt aber auch langweilige Fernsehserien im Unterschied zu spannenden Fernsehserien.
Akzeptieren muss ich das nicht! Ich beklage mich über die Fernsehserie, indem ich sage, die Fernsehserie sei langweilig. Beides - Verstehen und Akzeptieren - passiert gleichzeitig.
Wenn Kati nur versteht, warum ihre Tante so ist, dann akzeptiert sie das Verhalten ihrer Tante. Und wenn Kati nur das Verhalten zurückweist, versteht sie nicht mehr das Leid, aus dem ihre Tante heraus handelt.
Kati und Jana streiten sich also, weil Jana nicht handeln will und weil Kati nicht ihre Weltsicht überdenken will. Jana blockiert sich, weil sie Kati und ihrer Familie nicht das Recht zugesteht, Leiden, Rache und Lügen von sich fern zu halten. Und Kati blockiert sich, weil sie lange Zeit Angst hatte, dass sie sich nicht mehr gegen ihre Tante wehren kann, wenn sie ihre Tante versteht.
Heute weiß Kati zum Glück, dass sie sich gegen ihre Tante wehren muss, gerade weil sie sie versteht.
Und sie weiß mittlerweile auch, dass sie, wenn sie ihre Tante als Täterin sieht, ihrer Tante nicht nur die Schuld zuweist, sondern auch ausdrückt, dass ihre Tante sie leiden lässt. Mit Schuldzuweisungen sollte man sehr vorsichtig sein: hier hat Jana Recht, wenn sie darauf hinweist, dass Kati's Tante auch ein Opfer ist. Aber dass Kati handelt und sich wehrt, weil sie unter dem Verhalten ihrer Tante leidet, ist ebenso richtig.