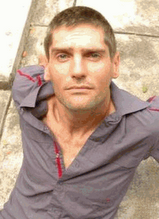Immer wieder höre ich von Menschen, die in ihrer Familie mit Menschen zusammen leben, die extrem manipulieren. Diese Menschen tragen eine tiefe Verunsicherung in ihre Umgebung hinein und meist entstehen bei nahen Familienmitgliedern auch schwere psychische Störungen.
Wie kann man mit solchen schweren psychischen Störungen umgehen?
Ich möchte zunächst auf eine mögliche Diagnostik eingehen (I) und dann kurz auf ein Modell aus der Familientherapie eingehen (II), auf den Ausdruck "Familienterroristen" (III) und ob man Manipulationen verstehen soll (IV). Schließlich möchte ich auf die Schilderung einer problematischen Situation aus diesem Gebiet eingehen (V).
I Diagnostik nach dem ICD-10
Dissoziale Persönlichkeitsstörung
Für die dissoziale Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.2) typisch sind eine niedrige Schwelle für aggressives und gewalttätiges Verhalten, sehr geringe Frustrationstoleranz, Verantwortungslosigkeit und Missachtung sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen, ein fehlendes Schuldbewusstsein, mangelndes Lernen aus Erfahrung oder Bestrafung, mangelndes Einfühlen in andere. Beziehungen werden eingegangen, jedoch nicht aufrechterhalten. Teilweise sind Dissoziale auch erhöht reizbar. Aus diesen Gründen neigen Patienten mit dissozialer Persönlichkeitsstörung zu Gewalttaten, Kriminalität und Drogen- bzw. Alkoholmissbrauch. Der veraltete Begriff "Psychopathie" für diese Störung wird in der aktuellen Literatur nicht mehr verwendet.
Emotional instabile Persönlichkeitsstörung
Die wesentlichen Merkmale der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.3) sind impulsives Handeln ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, ständig wechselnde Stimmungslagen, Unfähigkeit zur Vorausplanung, heftige Zornesausbrüche mit teilweise gewalttätigem Verhalten und mangelnde Impulskontrolle.
Histrionische Persönlichkeitsstörung
Kennzeichnend für die histrionische Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.4) sind Übertreibung, theatralisches Verhalten, Tendenz zur Dramatisierung, Oberflächlichkeit, labile Stimmungslage, leichte Beeinflussbarkeit, dauerndes Verlangen nach Anerkennung und der Wunsch, stets im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, erhöhte Kränkbarkeit, sowie ein übermäßiges Interesse an körperlicher Attraktivität.
Das Problem bei diesen Diagnosen ist, dass sie "irgendwie" auf jeden Menschen zutreffen können. Ich möchte Sie, liebe Leser, also bitten, diese Krankheitsbilder zwar zur Kenntnis zu nehmen, sie aber nicht ständig in der Umwelt zu sehen.
Jeder verantwortungsvolle Arzt stellt differentielle Diagnosen, das heißt, er überprüft seine eigene Diagnose auf ihre Realität, indem er andere, ähnliche Krankheitsbilder hinzuzieht.
Es ist nicht unsere Aufgabe, solche Diagnosen zu stellen. Selbst manche Pychiater sind nicht in der Lage, hier angemessen zu urteilen. Warum also sollten wir dies können?
Wozu stelle ich hier also Krankheitsbilder vor, wenn ich dann ausdrücklich davor warne, sie zu diagnostizieren?
Aus einem einfachen Grund: zunächst helfen uns diese Krankheitsbilder, gegenüber unangenehmen Menschen eine Distanz zu wahren. Nicht die Richtigkeit des eigenen Urteils ist hier wichtig, sondern die Heilsamkeit der Distanz.
II Delegation
Wer sich mit verworrenen Familienbeziehungen auseinandersetzt, wird immer wieder mit einem Phänomen konfrontiert, das höchst erstaunlich ist: Bestimmte Familienmitglieder brechen aus dem Familienalltag in geradezu bestürzender Weise aus, aber niemand sieht es und wenn es gesehen wird, wird es vollkommen widersprüchlich verteidigt.
Dieses Phänomen lässt sich ganz gut mit dem Begriff der Delegation erklären.
Wie in einem Betrieb Aufgaben an Mitarbeiter delegiert werden, so werden häufig in Familien bestimmte psychische Rollen an die Mitglieder delegiert. So besitzt fast jede steinharte und zwanghafte Familie ihren Rauschsüchtigen oder Rauschgiftsüchtigen.
Warum?
Kein Zwang lässt sich ohne ein bisschen Karneval aushalten. Wie manche Zwangskranken zugleich äußerst fröhliche, satirische oder zynische Menschen sind, so können Familien, in denen Zwänge eine große Rolle spielen, die extrem rauschhaften Menschen genau dieses Entlastungsventil spielen, die zum Aushalten der Zwänge notwendig ist.
Nun will der betreffende Mensch nicht unbedingt ein so abhängiger Mensch sein. Es ist ja nicht nur gesundheitsschädigend, sondern verhindert auch jedes normale Leben, jede Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.
Delegationen kommen in zahlreichen Spielarten vor.
1. So soll der Sohn die Konflikte mit der Mutter austragen, die der Vater sich nicht auszutragen traut.
2. Die Tochter soll einen solchen Mann heiraten, den die Mutter gerne geheiratet hätte.
3. Die Kinder sollen den Erfolg im Leben bringen, den die Eltern nicht haben konnten.
4. Die Kinder sollen die Fehler wieder gut machen, die die Eltern begangen haben.
5. Das Kind soll die Aggresionen oder Depressionen ausleben, die ein Elternteil sich nicht einzugestehen traut.
usw.
Alle Delegationen aber gehen mit Manipulationen einher und die sicherste Form, einen Menschen zu manipulieren, ist,
- ihm fortlaufend bestimmte Absichten zu unterstellen und
- ihn von der Umwelt und anderen sozialen Kontakten weitgehend zu isolieren.
III Familienterroristen
Neulich habe ich dann folgendes Wort gelesen: Familienterroristen. Dieses geht auf einen Artikel von Erin Pizzey zurück.
1. Es ist zwar nur ein kleines Wort, aber ...
"Zwar sind Männer nach meiner Erfahrung ebenso in der Lage, sich als Familienterroristen zu gebärden, doch neigen sie eher zu physischen Gewaltausbrüchen."
Zitat aus dem Artikel
Ok, ich habe selbst ein solches Wort: Harmonieterroristen. Das sind Menschen, die einen mit ihrer Harmonie schwere Schrecken einjagen (terror = tiefgehender Schrecken). Ich habe keine Probleme damit, dieses Verhalten Männern wie Frauen vorzuwerfen, ebenso habe ich keine Probleme damit, Frauen anderen Terror vorzuwerfen, gleich welcher Art. Man denke doch bitte nur an die Diskussion um Brigitte Mohnhaupt.
Allerdings: Familienterroristen, DOCH dann eher physische Gewalt; damit wird doch gesagt, dass Terror keine physische Gewalt beinhaltet, während physische Gewalt noch kein Terror ist!
Aus meiner täglichen Arbeit erfahre ich immer wieder, dass es vor allem die Männer sind, die sowohl psychisch als auch physisch terrorisieren. Andererseits gibt es Frauen, die extrem eifersüchtig sind, die stalken (zwanghaft einen Mann verfolgen), die eine ganze Familie in Atem halten können, sei es durch extreme Rachsucht oder erpresserische Angstattacken.
Wie gesagt, ich habe keine Probleme, Frauen Gewalttätigkeiten vorzuwerfen. Wenn ich mit einer solchen Frau arbeite, gehe ich meist auf dieses Verhalten direkt zu. Bei Männern finde ich das schwieriger. Frauen sehen eher ein, dass sie etwas falsch machen, als Männer. Manche Frauen legen zwar wutentbrannt auf, wenn ich ihnen sage, dass sie die Probleme verursachen, meist aber rufen sie wieder an. Männer sind dort wesentlich krankheitsuneinsichtiger.
Natürlich gelten diese Sätze nur statistisch, nicht aber im besonderen Fall.
Zudem lösen sich die geschlechtsspezifischen Störungen mehr und mehr auf, weil die Geschlechterrollen immer mehr aufgelöst werden, durch Homosexualität, metro sexuality (David Beckham), und so weiter. Jedenfalls gibt es mittlerweile fast so viele Männer mit Essstörungen wie Frauen mit narzisstischer Wut (Mädchen biss Mädchen ein Ohr ab - so titelte letzte Woche die Berliner Zeitung). Ich schreibe hier also gegen eine allzuleichtfertige Abgrenzung zwischen Männern und Frauen, zwischen psychischer und physischer Gewalt. Es mag ja sein, dass der eine oder andere es zu penibel findet, hier auf den kleinen Wörtern herumzuhacken, die eigentlich zwischen dem eigentlichen Inhalt stehen - wie hier dem Wörtchen "doch".
Andererseits sind es gerade diese Präpositionen (doch, weil, während, seit, ...), die unsere alltägliche Logik durchscheinen lassen.
2. Familienterrorismus
Hierzu verweise ich sehr generell auf die Erforschung systemischer Familienstrukturen von der Seite einiger Psychiater, wie z.B. Helm Stierlin ("Familie und Delegation", suhrkamp) und Fritz B. Simon ("Unterschiede, die Unterschiede machen", suhrkamp). Beide berufen sich auf den amerikanischen Anthropologen Gregory Bateson.
Aus dieser Ecke stammt der Begriff der psychischen Delegation, der mit dem des Familienterrorismus eng zusammenhängt.
In der psychischen Delegation werden Seelenanteile eines Familienmitgliedes anderen Familienmitgliedern aufgezwungen. Man kann sich das in etwa so vorstellen wie eine Familienaufstellung in umgedrehter Richtung, nicht heilend eben, sondern krankmachend.
Dass hier Frauen nicht spezifisch benannt werden als diejenigen, die ihre Familien terrorisieren, liegt in der Art der Theorie: sie interessiert sich nicht für eine Ursachenforschung, sondern für die Praxis des Krankmachens und die Praxis des Heilens, das heißt, für Prozesse der Veränderung. Es gibt keinen "weiblichen" Kern in der Krankheit.
Wer also meint, das terrorisieren bei einer Frau auszumachen, der hat noch lange nicht Unrecht. Wer aber sagt, dies sei ausschließlich ein Problem der Frauen, der hat sicher nicht Recht.
3. Spirituelle Aufgabe?
Jede Erfahrung hat natürlich ihren spirituellen Anteil. Nur: ist die Spiritualität eine Aufgabe (ich weiß, ich bin wieder zu penibel), oder ist sie nicht Bedingung unserer (Lebens-)Aufgaben? So würde ich es nämlich eher sehen.
Und ganz allgemein gehalten ist die Aufgabe hier doch: Einsicht in die menschlichen Möglichkeiten, Distanzierung von den menschlichen Möglichkeiten, die schädlich und krankmachend sind.
IV Muss man Manipulationen verstehen?
Natürlich ist jede physische Gewalt auch psychische Gewalt!
Physische Gewalt ist die Handlung, die gewalttätig ist, aber die Möglichkeit dazu muss ja in dem jeweiligen Menschen mitgegeben sein.
Wer andere Menschen misshandelt, hat fast immer (und ich kenne eigentlich keine Ausnahme) Seelenanteile, mit denen er sich selbst psychisch misshandelt. In solchen Fällen rate ich zwar immer dazu, die Hintergründe zu verstehen, sie aber nicht zu akzeptieren.
Ich rede jede Woche mit mindestens fünf Frauen, denen ich erkläre, warum ihr Mann oder ihr Freund sie schlagen oder anderweitig misshandeln. Ganz zwangsläufig folgt die Frage: "Ja, soll ich jetzt zu meinem Mann zurückkehren?"
Nein! - Ganz klar nicht! Gewalt muss zwar verstanden werden - und möglichst gründlich verstanden, aber nie! nie! nie! sollte man sie akzeptieren. Verstehen und akzeptieren sind zwei verschiedene Sachen. Verstehen bedeutet, eine spirituelle Gelassenheit zu entwickeln. Akzeptieren bedeutet, die Gefühle eines anderen in sich eindringen zu lassen. Gewalt darf nie akzeptiert werden.
Auch Manipulationen wie extreme Eifersucht und die Isolierung des Partners von seinen Freunden und seiner Familie sind eine Form von Gewalt.
Verstehen: das ja!
Akzeptieren: auf gar keinen Fall!
V Und wie damit umgehen?
Eine Frau schildert mir ihren Fall aus ihrer Familie so:
Der Täter als Opfer
"Weiterhin ist mir vollkommen bewusst, das auch die Täterin (nennen wir sie mal so) aufgrund eigener Schmerzen, Erfahrungen, Ängste, Leiden usw. handelt und eine eigene bittere Familienstruktur in sich trägt, die sie in dem Kreislauf festhängen lässt... Bis zu einen gewissen Grad habe ich dafür Verständnis, sonst würde mich gar nicht interessieren, wie die Täterin dem ganzen entkommen kann und welches die Lernaufgabe auf spiritueller Ebene für sie sein könnte."
Wobei hier deine Aufgabe und niemandes Aufgabe das Aushalten und Hinnehmen sein kann. Es ist zwar richtig, dass Täter immer auch Opfer sind (und waren). Deshalb allzuviel Verständnis für sie zu haben, halte ich aber für grundlegend falsch.
Intrigen und Rache
"Ich möchte zur Veranschaulichung ein paar kurze Beispiele anführen: Die Täterin hat nach meinem Austritt aus der Familie meiner Oma einen Herzinfarkt mit vollem Bewusstsein und mit purer Absicht beschert, sie hat mich (zeitweise) gezielt in den finanziellen Ruin getrieben, hat Rufmord betrieben, hat Intrigen gesponnen, ständige Drohungen ausgesprochen, Racheaktionen durchgeführt ohne Rücksicht auf Verluste egal für wen usw. ..."
In solchen Fällen empfehle ich hier die ausführliche Dokumentation, auch wenn es sich um einen engen Verwandten handelt und ein gerichtliches Vorgehen. Auch wenn die Täterin Opfer war, müssen bestimmte Verhaltensweisen ausgebremst werden. Unsere Gesellschaft bietet dafür die staatliche Gewalt und die sollte man sich in solchen Fällen zunutze machen.
Sensibilität für den Täter?
"Als sensibler, verständnisvoller Mensch habe ich stets im Hinterkopf gespeichert, das die Täterin ihre eigene schlimme Lebensgeschichte mit sich herumträgt und daher vielleicht einfach nicht anders handeln kann."
Man kann immer anders handeln. Man muss es nur wollen und dann - zumindest versuchsweise - in die Tat umsetzen. Wer sich hier krankmacht, wer sich in seinem Krankmachen genießt - und das scheint mir bei dieser Frau der Fall zu sein - muss eben hart in seine Schranken verwiesen werden.
Psychosoziale Erbschaften
"Doch, jetzt kommt der Knackpunkt. Ich selber habe dank dieser Täterin eine sehr "reiche" Vergangenheit und es wäre durchaus denkbar gewesen das ich ebenfalls in so einen Kreislauf rutsche und meine Vergangenheit wiederrum an anderen auslebe ..."
Hier findest du auch deine spirituelle Aufgabe: die positive Wirkung negativer Erlebnisse gelassen anzuerkennen. Die Situation hat dich sehr geprägt und trotzdem und vielleicht gerade deswegen hast du dich zu der Frau gewandelt, die du heute bist. Der Täterin musst du deshalb trotzdem nicht dankbar sein. Der umgedrehte Weg: die Rache - nun, ich denke, die Frau führt dir gut genug vor, wie unsinnig dieser Weg ist. Also: Gelassenheit heißt, hier etwas zu lassen - die Änderung durch Nicht-Änderung: nicht dich zu ändern, nicht diese Frau zu ändern, sondern mit ruhiger Hand seinen eigenen Weg zu gehen.
Verantwortung: psychosoziale Erbschaften vermeiden
"Tue ich aber nicht, nicht in der beschriebenen negativen Form. Kommt nicht jeder Erwachsene, klar denkende Mensch irgendwann an diesen Punkt, wo er sich fragen muss: will ich so sein wie ich sein will oder lasse ich es zu, dass ich ein Abklatsch meiner Vergangenheit werde und es nicht besser mache, als es mir zuteil wurde? Hat nicht jeder die freie Wahl, es anders zu machen?"
Verantwortung eben: die Verantwortung ist immer ein Bruch mit der Vergangenheit.
Die Möglichkeit hat jeder
"Ich habe es getan. Kann daher das Argument: Die Täterin war selber Opfer überhaupt gelten? Hatte sie nicht die Wahl sich ihrer Opfer Rolle und somit Täterrolle zu entledigen? Oder wurde mir nur unglaubliches Glück zuteil, oder große Stärke, das ich nun die erste in dieser Generation bin, die diesen Kreislauf durchbricht?"
Natürlich hat jeder die Möglichkeit. Nicht jeder ergreift sie. Toll, dass du es geschafft hast.
Wer sich so blind stellt, dass er nicht sieht, welches Leiden er auslöst und wie ungerecht er dabei ist, kann eigentlich nur mit sehr viel Härte zur Verantwortung gezogen werden. Von einem wachen und sensiblen Menschen erwartet man das sowieso.
Die Wiederholung der Situation
"Auf Abstand bin ich gegangen. Aber, wie den Abstand wahren, wenn wieder versucht wird der Existenz, der Gesundheit, dem Ruf und dem Seelenfrieden einiger Familienmitglieder zu schaden? Genau das geschieht nämlich gerade. Betonung liegt klar auf "Es wird VERSUCHT", denn diesmal mit genügend emotionalem Abstand und Hintergrundwissen kann ich differenzierter und sachlicher damit umgehen, Ruhe bewahren und bislang noch dafür Sorge tragen, dass es beim Versuch bleibt ..."
Wie ich oben schon gesagt habe: hier solltest du, wenn Straftatbestände wie Verleumdung, Belästigung, Sachbeschädigung und ähnliches vorliegen, ganz klar auch gerichtliche Maßnahmen ergreifen. Letzten Endes ist diese Frau krank, vielleicht sogar krank im Sinne einer massiven Persönlichkeitsstörung. Dich dagegen alleine zu schützen und hier womöglich noch andere mit zu schützen ist extrem energieraubend, da du es mit starken negativen Kräften zu tun hast. Und genau hier ist es sinnvoll, die Krise zurückzugeben und - zwar eben mit Gelassenheit, aber doch deutlich - hier zu sagen: du hast das Problem. Auch dazu sind Polizei und Gerichte da.
Gerechtigkeit üben heißt nicht, niemandem zu schaden
"Nun wäre interessant, was der psychisch sinnvollste Weg ist, die Situation zu händeln, so dass niemand schaden erleidet, weder Täter noch Opfer ..."
Wie gesagt: mein Eindruck ist hier, dass du alleine das auf Dauer nicht schaffen wirst. Jede Rücksichtnahme ist hier auch deshalb unsinnig, weil die Täterin nicht nur den Schaden schon erlitten hat, sondern ihn stets weiter tragen wird: sie kann die Möglichkeit zur Heilung nur dann bekommen, wenn sie auf diese Brüche zurückgeworfen wird und sich nicht ständig mit Racheaktionen und ähnlichem ablenkt. Dazu muss ihr aber auch deutlich gezeigt werden, dass sie das Problem ist, weil sie das Problem hat. Und - ganz hart gesagt -: manchmal muss man auch die Heilung eines Menschen aufgeben und einfach akzeptieren, dass dieser krank ist und krank bleiben wird.
"... und gibt es eine spirituelle Lernaufgabe hinter dem ganzen, ..."
siehe oben
"... irgendwas greifbares was der Täterin helfen könnte, denn das ist wohl das einzige (Hilfe für die Täterin), was am Ende der ganzen Familie aus der Patsche helfen könnte ..."
Das sehe ich nicht so.
1. Die Täterin sollte ganz deutlich auf ihre eigentlichen Probleme hingewiesen werden. Ihre eigentlichen Probleme sind nicht böse Vergangenheiten und ähnliches, sondern ihr aktuelles Verhalten. Wenn sie nicht mit diesem Verhalten brechen kann, dann muss es von außen initiiert werden.
2. So oder so wirst du die krisenhafte Entwicklung bei dieser Frau nicht abwenden können. Die Frage ist nur, wie viele Menschen sie noch mit sich zieht. Je schneller sie aber in die Krise kommt (crisis = Höhepunkt, der Moment, in dem alle Konflikte gemeinsam "auf der Bühne" stehen), umso eher wird sie sich hier wandeln können (nach der crisis kommt die katharsis: die Heilung, bzw. Reinigung, wobei dies im realen Leben nicht so gut funktioniert wie auf der Bühne). Ich würde hier also keine Kompromisse eingehen.
Ganz wichtig finde ich, dass du vor allem den Kindern hilfst, die Sache mit Humor zu tragen.
Fliegersirenen und KinderbilderDie Situation passt hier vielleicht nicht so ganz, aber eine Bekannte hat ihre zukünftige Schwiegerfamilie ziemlich in Aufruhr versetzt und zwar auf folgende Weise:
Sie saß mit ihrem Verlobten bei der Schwiegermutter und deren Familie am Mittagstisch (es ging um irgendeine Familienfeier). Die Schwiegeroma hatte irgendein scheußliches Fleisch gekocht und einige der Kinder mochten dieses Fleisch nicht essen (eigentlich mochte niemand dieses Fleisch essen, aber alle Erwachsenen waren gegenüber der Oma zu höflich). Jedenfalls weigerte sich eines der Kinder, worauf die Oma mit einem Pseudoheulen anfing und jammerte: Der P... hat mich nicht mehr lieb, etc.
Hier hat meine Bekannte eingegriffen. Sie fragte P..., ob es wisse, dass seine Oma im Zweiten Weltkrieg eine berühmte Fliegersirene gewesen sei. P... schüttelte den Kopf. Ja, so erzählte meine Bekannte weiter, sie habe ganze Stadtviertel vor dem Untergang bewahrt, weil sie so schön heulen konnte.
Hinterher gab es natürlich einen Riesenkrach. Einige in der Familie waren erbost von dieser Unhöflichkeit, andere waren auf ihre eingeschüchterte Art und Weise sehr beeindruckt.
P... selbst hat in mehreren Bildern diese Fantasie weiterverarbeitet. Er hat seine Oma gemalt, wie sie auf dem Dach sitzt und heult, während die Flieger ihre Bomben abschmeißen und die Menschen vor ihnen fliehen. Außerdem hat er seine Oma gemalt, wie sie im Garten auf ihrem Liegestuhl sitzt und seine Mutter dazu schreiben lassen: Liebe Oma! Du musst nicht mehr heulen. Der Krieg ist vorbei.
P... hat sich später sehr mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt und zwar schon in jungen Jahren (er ist jetzt, soviel ich weiß, zwölf). Zu seiner Oma hat er ein recht distanziertes Verhältnis und seine Tante liebt er heiß und innig. Mit seinem Vater, der seine Schwägerin unmöglich fand, hat er wohl häufig Krach und zu seiner Mutter, die in der Ehe ziemlich duckmäusert, ein eher kühles Verhältnis.
Ein Problem in dieser Familie ist auch immer wieder, dass zwar viele die Probleme sehen, aber jeder zu höflich ist, diese deutlich auszusprechen und damit aus ihrem statischen Dasein zu befreien. P.'s Oma ist - soweit ich das mitbekommen habe - eine sehr manipulierende Frau und P.'s Vater ein steinharter und sehr dogmatischer Mensch. P. selbst sucht sich hier vor allem Kontakte zu den Familienmitgliedern, die deutlich die Konflikte ansprechen und humorvoll sind. Er malt immer noch sehr gerne und will nicht - wie sein Vater - Ingenieur werden, sondern Künstler.
Die Moral der Geschichte ist einfach: Wer die Täter schützt - und wenn auch nur durch zu viel Verständnis -, zwingt die Mitleidenden zu einer irgendwie gearteten Teilnahme an dem kranken Spiel. Sicher war meine Bekannte mit ihrem Einsatz sehr grob: andererseits musste sie so deutlich werden, um dem Kind hier überhaupt eine Möglichkeit zu bieten, sich von diesem Terror zu distanzieren und die Situation umdeuten zu können. So unwahr diese Umdeutung war, so nützlich war sie.
Auch dir würde ich nicht empfehlen, die Täterin zu schützen. Wenn du andeutest, dass sie die ganze Familie belastet (oder: in die Patsche bringt), dann ist es höchste Zeit, hier Grenzen zu setzen.
Adrian


 Zehntausende Frauen fühlen mit dir.
Zehntausende Frauen fühlen mit dir.